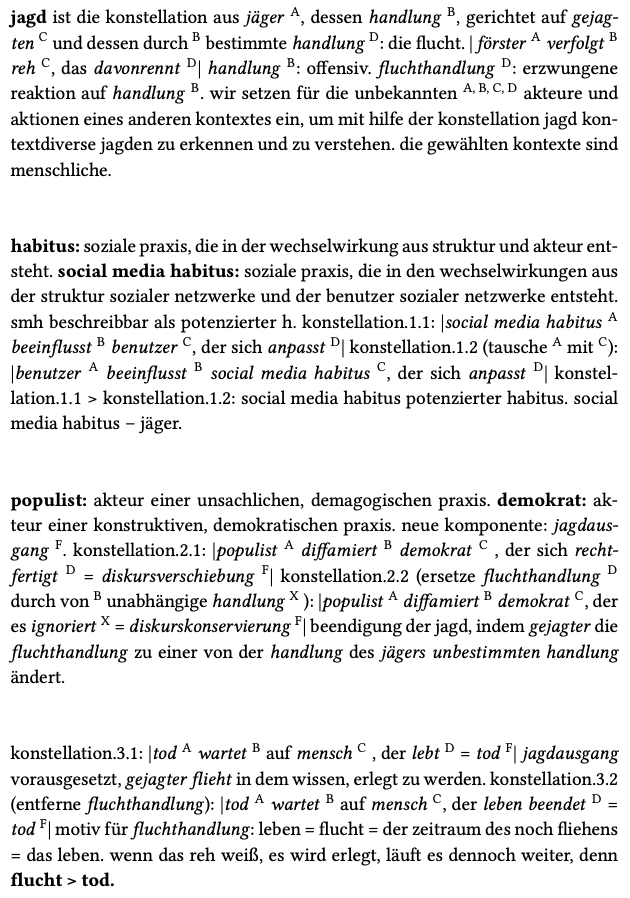HINWEIS: IN DIESER ONLINE-AUSGABE BEFINDEN SICH NUR TEXTE DER RUBRIK „FREIER TEIL“. FÜR DEN GENUSS EINER VOLLSTÄNDIGEN AUSGABE KONTAKTIEREN SIE UNS PER MAIL (autorenseelsorge@literatur-wuerzburg.de) ODER BESTELLEN SIE EIN EXEMPLAR AUF liberladen.org.
FÜR IHR LEBEN (UND EIN WENIG ZUR AUSGABE) … Eigentlich wollte ich hier mit einer intellektuellen Hasstirade beginnen, auf hohem und subtilen Niveau mit denen abrechnen, die mich an meinem Tisch unter meiner Gastfreundschaft dumm von der Seite herabbeleidigen, die den guten Leuten und engagierten Projekten permanent Steine in den Weg legen und andere klein machen müssen, weil sie selbst mikrig sind und unfähig, überhaupt für ihr eigenes Leben die Verantwortung zu tragen.
— Aber drauf geschissen. Ich möchte Ihnen raten, werte Leserin, werter Leser, geben Sie nichts auf die kleinkarierten und neidischen Reden derjenigen, die an Ihnen und Ihren Projekten zweifeln, umgeben Sie Sich mit den Leuten, die Sie hochziehen – nicht mit denen, die Sie zu sich herunterholen müssen, um ihre eigene Unfähigkeit und Begrenztheit ertragen zu können. Glauben Sie selbst an Ihre Projekte, glauben Sie an Sich und scheuen Sie Sich nicht, einen Weg zu gehen, den niemand versteht – ein Pionier ist niemand, der unter dem Beifall der Massen über asphaltierte Alleen dahinrollt.
Was ich Ihnen aber auch raten möchte – und wenn Sie das nicht beherzigen, sind Sie auch nicht wesentlich besser als die oben beschriebenen –: Gehen Sie den langen Weg! Es gibt keine Abkürzungen, man kann nicht 50 Jahre Arbeit, Kampf und Niederlage überspringen und gleich reich und weise auf der Veranda sitzen und kubanische Zigarren rauchen. Mein Lieblingsausspruch – in der Form habe ich ihn von Feuchtwanger – stammt aus dem Talmud, wenn Sie einmal eine Mail von mir bekommen haben, dann haben Sie ihn schon im Fuß gelesen: »Es ist uns aufgetragen, am Werk zu arbeiten, aber es ist uns nicht gegeben, es zu vollenden.« – Wir müssen einsehen, dass wir uns nie anmaßen dürfen, uns am Ziel zu sehen und uns stärker zurückzulehnen, als es Geist und Körper hin und wieder brauchen. Denn ja, natürlich gibt es Zeiten, bloß zu denken und dahinzutreiben, genau wie es Zeiten gibt, zu reden. Hauptsächlich aber ist es mehr denn je die Zeit, die Fresse zu halten und ranzuklotzen – Mögen Sie es noch direkter ausgedrückt, habe ich nur noch Reichskanzler Bismarck für Sie: »Für die Jugend habe ich nur drei Worte als Ratschlag: Arbeite, arbeite, arbeite.«
Gehen Sie also raus und nehmen die Axt und hacken einen Festmeter Holz. Und dann setzen Sie Sich an den Computer und fangen an, zu schreiben. Das Schreiben ist die schwerste aller Arbeiten, weil niemand es braucht, außer das Innerste des Menschen – und um dieses dumm zu berieseln wurden nach und nach Methoden wie Instagram, 9GAG und die BILD erfunden.
Schirach – Sie mögen sein Zeug mögen oder auch nicht – hat völlig Recht, wenn er sagt, dass es zum Schreiben keine Abkürzung gibt, dass es keinen Trick gibt außer den, sich jeden Tag vor die Schreibmaschine zu setzen und zu schreiben, jeden Tag, 50 Jahre lang. Sie dürfen dabei auch an Sich und an der Welt und erst Recht an Gott und dem Menschen zweifeln, nur an einem sollten Sie nie zweifeln: am Schreiben selbst! Schreiben Sie also, Leben Sie, seien Sie eine positive Veränderung.
Nun doch noch wenigstens ein Wort zur Ausgabe: Nehmen Sie die Texte, nehmen Sie bitte nur das Gute mit heraus, das Erbauliche, denken Sie an die freiheitlich-demokratische Grundordnung, denken Sie an den Humanismus. Suchen Sie die Worte, die verbinden – nicht die, die trennen. Mein Dank und meine Hochachtung gelten Anton Ehrmanntraut für den grandiosen Satz; ein Lob schulde ich Götz und Hart, ihre Texte seien Ihnen besonders empfohlen. Denken Sie einmal über sie nach; genau wie über die Kolumne, diesen – so der Autor höchstselbst – »moralische[n] Tritt in die Fresse«. Und eines noch bitte: Lassen Sie die Finger vom Alkohol, nicht heute Abend – er hat nie irgendetwas erbaut – und auch von dem ganzen Zuckerwasser, das macht nur fett und krank. Trinken Sie Wasser (wie Ziegler) oder Kaffee (wie Schirach) oder Rotbusch-Tee (wie ich). Schauen Sie heute Abend noch einen guten Gangsterfilm (einen in dem die Männer noch Fedoras tragen und Autos noch unsynchronisierte Getriebe haben, ich kann Ihnen »Die Unbestechlichen« von 1987 sehr ans Herz legen) und Morgen gehen Sie wieder an die Arbeit; so wie ich es gleich tue, wenn das hier geschrieben ist. In 50 Jahren sprechen wir uns wieder – außer ich fahre vorher schon auf drei Wochen nach Davos ins Sanatorium.
Herzlich,
Ihr weißer, privilegierter cis-Mann vom Dienst
PS: Wenn Sie jetzt doch noch die Geschichte hören wollen, wie diese Ausgabe an einer bunten, verschwitzten Tafel; in einem Schmelztiegel von Alkohol, zu großen Egos, wirren Texten und zu viel Rauch auf die Welt kam und in einigen Wochen harter Arbeit aus Lesen, Korrigieren, Schreiben loop Korrigieren, Schreiben loop … erwachsen wurde, dann kommen Sie doch in der Redaktion vorbei, besuchen Sie uns am Schreibtisch, wo wir über Kopf in den Papieren vergraben sind. Wir nehmen uns die Zeit für Sie, den Moment des Denkens und Redens, bevor es wieder mit voller Kraft weitergeht … Vielleicht verstehen Sie dann etwas besser, was und wie viel hier drin steckt.